UN-Sonderberichterstatterin empfiehlt Brasilien umfassende Maßnahmen zum Schutz von Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidigern und ein Ende der Straflosigkeit
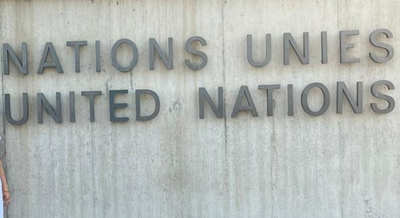
Von Christian Russau
Der Bericht „Visit to Brazil“ kann in ganzer Länger im Dokument A/HRC/58/53/Add.2 (hier auf Englisch; hier auf Spanisch) eingesehen werden. Der Bericht dient (als einer von vielen Berichten zu verschiedenen Ländern) zur allgemeinen Debatte in der 58. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates, die am 24. Februar in Genf startet und bis zum 4. April dieses Jahres dauern wird. Zielsetzung des Berichts und der Empfehlungen sind die Förderung und der Schutz aller Menschenrechte, der bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, einschließlich des Rechts auf Entwicklung.
Die Sonderberichterstatterin über die Situation der Menschenrechtsverteidiger:innen, Mary Lawlor, hatte Brasilien vom 8. bis 19. April 2024 einen offiziellen Besuch abgestattet. Ziel des Besuchs war es, die Situation von Menschenrechtsverteidiger:innen im Land vor dem Hintergrund der Verpflichtungen des Staates im Rahmen der internationalen Menschenrechtsnormen zu beurteilen.
Eine der Kernaussagen des Berichts von Mary Lawlor: Die anhaltende Verweigerung des Zugangs zu Land steht im Mittelpunkt des Kampfes der indigenen und traditionellen Völker und Gemeinschaften und der ländlichen Arbeiter:innenin ganz Brasilien. Sie habe wiederholt und übereinstimmend von vielen Menschenrechtsverteidiger:innen bei ihrem Besuch in Brasilien gehört, dass der Zugang zu Land der Schlüssel sei für das Überleben der indigenen und traditionellen Völker und Gemeinschaften. Menschenrechts. Die UN-Sonderberichterstatterin zitiert so z.B. mehrere indigene Menschenrechtsverteidiger:innen, die in diesem Zusammenhang mit Landkonflikten zur Zielscheibe von Gewalt, Drohungen, Anschlägen und Übergriffen wurden, „was sie ihrer Meinung nach schützen würde, waren sie sich einig: die Ausweisung derer, die in ihr Land eindringen, die rasche Abgrenzung ihrer Territorien und die Rechenschaftspflicht für Umweltverbrechen“. Gleiches antworteten der Sonderberichterstatter die Menschenrechtsverteidiger:innen aus den Quilombola-Gemeinschaften: Als Mary Lawlor diese fragte, „welche Maßnahmen der Staat ergreifen müsse, um der Gewalt, der sie ausgesetzt sind, zu begegnen, waren sie sich einig: die dringende Titulierung ihres Landes, angemessene Untersuchungen, um die Straflosigkeit zu beenden und soziale Rechte zu garantieren, damit jede/r in Würde leben kann“.
In diesem Zusammenhang kritisiert die UN-Sonderberichterstatterin explizit die These vom sog. „Marco Temporal“, die (von der konservativen Mehrheit in Brasiliens Nationalkongress wiederholt auf die politische Agenda gesetzte) Stichtagsregelung, nach der indigene Völker, die bei der Ratifizierung der brasilianischen Verfassung am 5. Oktober 1988 noch nicht (oder nicht mehr) auf ihrem Land lebten, keinen Anspruch auf dieses gleichwohl traditionelle Land haben dürften. Mary Lawlor nannte im gleichen Abschnitt auch die Ermordungen von Quilombola-Anführer:innen und die Entwicklung von Monokulturen auf dem traditionellen Land der indigenen Völker, die Verschmutzung von Flüssen, die von Flussgemeinschaften genutzt werden, durch legalen und illegalen Bergbau sowie die Zwangsumsiedlung traditioneller Gemeinschaften.
Die UN-Sonderberichterstatterin konstatierte in ihrem Bericht zudem, dass es indigene Frauen, Quilombola-Frauen und Landarbeiterinnen sind, die die sozialen Bewegungen anführen, um sicherzustellen, dass die Menschenrechte in ihren Gemeinschaften geachtet werden. Die Risiken, die diese dabei eingehen würden, seien immens, so Lawlor: „Ihre Familien und Kinder werden zur Zielscheibe, und sie werden sexuell belästigt und missbraucht.“ Das Gleiche gelte für Schwarze Frauen, Transgender-Frauen, Journalistinnen.
Lawlor konstatiert des Weiteren, dass bei „fast allen Treffen mit der Sonderberichterstatterin wiesen Menschenrechtsverteidiger:innen auf die Rolle der Wirtschaft und der Märkte als treibende Kräfte für die Risiken, denen sie ausgesetzt sind, hin“. Selbst Vertreter:innen des Staates identifizierten ihr gegenüber „auch räuberische, neokoloniale Aspekte der brasilianischen Wirtschaft als Ursache für die Angriffe und die Unsicherheit, unter denen die Menschenrechtsverteidiger leiden“. Zu den hauptsächlichen Branchen, die der Sonderberichterstatterin gegenüber als Risiken für Menschenrechtsverteidiger:innen in Brasilien identifiziert wurden, befinden sich „unter anderem Bergbau, Agrarindustrie, Tourismus, Wohnungsbau und der entstehende Kreditmarkt. Viele dieser Sektoren werden durch ausländische Investitionen angetrieben, aber auch nationale und Staatsunternehmen sind jedoch auch an der Entstehung von Konflikten beteiligt, die Menschenrechtsverteidiger betreffen“, so der Bericht der UN-Sonderberichterstatterin. Bei vielen dieser Projekte sei u.a. die von der ILO-Konvention 169 zum Schutze der Rechte der indigenen Völker geforderte freie, vorherige und informierte Konsultation der von Wirtschaftsprojekten betroffenen Indigenen nicht erfolgt.
„Diese Beispiele stehen auch für ein aufgezwungenes und umweltschädliches Entwicklungsmodell Entwicklungsmodells, das von ausländischen Investitionen angetrieben wird, die eher dem Profit der Aktionäre als der lokalen Bevölkerung vor Ort nutzt und das darauf abzielt, nicht nachhaltige Verbrauchsmuster und die Anhäufung von Reichtum im globalen Norden aufrechtzuerhalten, anstatt die Bedürfnisse der betroffenen Gemeinschaften zu erfüllen. Unter Bestehen auf diesem Modell, das historisch mit Unterstützung der brasilianischen Behörden entwickelt wurde, verdrängen und verunmöglichen solche Projekte nachhaltige Lebensweisen und die Nutzung von Land und natürlichen Ressourcen. Solche nachhaltigen Praktiken wurden von den Gemeinschaften über Jahrzehnten und Jahrhunderten entwickelt, sind fester Bestandteil ihrer Kultur und tragen zum Schutz der lokalen Umwelt und der biologischen Vielfalt sowie zur Bekämpfung des Klimawandels bei“, so die UN-Sonderberichterstatterin.
Allen diesen Fällen sei gemeinsam, so Mary Lawlor, „dass die Menschenrechte, die Umwelt und die Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels durch diejenigen erfolgt, die sich durch die Ausweitung des Kapitals bereichern und weiter ermächtigen. Angriffe auf Menschenrechtsverteidiger in diesen Kontexten sind eine Reaktion auf deren Beharren auf der Universalität der Menschenrechte und der Notwendigkeit, diese in jedem Fall zu respektieren und zu schützen“, so Mary Lawlor.
„Wie immer“, so die UN-Sonderberichterstatterin weiter, seien „Menschenrechtsverteidiger aus marginalisierten Gruppen und Gemeinschaften diejenigen, die historisch schon diskriminiert wurden, [und nun noch immer] einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, wenn sie sich organisieren, um die durch die Wirtschaftstätigkeit verursachten Menschenrechtsverletzungen zu verhindern.“
Der Bericht der UN-Sonderberichterstatterin führt des Weiteren aus: Eine Politik zum Schutz von Menschenrechtsverteidiger:innen wurde in Brasilien erstmals im Jahr 2007 eingeführt. Seitdem habe diese mehrere Änderungen und Rückschritte erfahren, unter anderem durch Änderungen in den Jahren 2019 und 2021 (unter der Regierung Bolsonaro), die von Menschenrechtsverteidiger:innen und der Zivilgesellschaft als Schwächung des Programms kritisiert wurden. Die Schutzpolitik und das ihr zugrunde liegende Programm wurden seit ihrer Einführung durch Präsidialdekrete aufgebaut worden. Die Bemühungen, dem Mechanismus einen solideren einen solideren Rechtsrahmen zu geben, unter anderem durch das Gesetz Nr. 4.575 aus dem Jahr 2009, haben sich bisher als erfolglos erwiesen, so die UN-Sonderberichterstatterin. Diese bisherige Erfolglosigkeit wurde von vielen Gesprächspartnern der Sonderberichterstatterin „als großes Problem bezeichnet“. Hinzu komme, dass obwohl das Programm von der Bundesregierung beaufsichtigt wird, werde es hauptsächlich mittels Vereinbarungen mit den Behörden auf Landesebene und wird von Partnern aus der Zivilgesellschaft Partnern umgesetzt. Zum Zeitpunkt des Besuchs der UN-Sonderberichterstatterin liefen in einer Reihe von Bundesstaaten zwar Programme, allerdings gab es mehrere Bundesstaaten, in denen Menschenrechtsverteidiger:innen ernsthaften Risiken ausgesetzt waren, da es dort gar keine Landesprogramme gibt. Wo kein landesstaatliches Schutzprogramm existiert, kann den bedrohten Menschenrechtsverteidiger:innen von der Bundesregierung Schutz geboten werden. Doch, so zitiert Mary Lawlor ihre Gesprächspartner:innen: „Wie von den Menschenrechtsverteidigern, mit denen der Sonderberichterstatter zusammentraf, deutlich gemacht wurde, ist das Bestehen des Schutzprogramms positiv. Es weist jedoch ernsthafte Probleme auf und muss vollständig überarbeitet werden.“
So erklärte laut dem UN-Bericht ein indigener Anwalt und Menschenrechtsverteidiger, wie er 2021 in das Programm aufgenommen wurde, aber dass es drei Jahre dauerte, bis jemand Kontakt zu ihm aufnahm. Eine indigene Anführerin sagte der Sonderberichterstatterin, dass sie eigentlich Unterstützung durch den Mechanismus erhalten sollte, aber dass sie nicht verstand, wie er funktionierte. Die Menschenrechtsverteidigerin, Quilombola und Mãe-de-santo Mãe Bernadete wurde in Bahia getötet, obwohl sie in das Schutzprogramm aufgenommen wurde.
Dem Bericht der UN-Sonderberichterstatterin zufolge könne das „Schutzprogramm derzeit nicht die Unterstützung bieten, die Menschenrechtsverteidiger benötigen und fordern. Die Probleme sind zahlreich. Es fehlt an finanziellen Mitteln und wird von Partnern aus der Zivilgesellschaft umgesetzt und nicht vom Staat, der die Pflicht hat, gefährdete Menschenrechtsverteidiger zu schützen. Es ist in hohem Maße von Schutzmaßnahmen abhängig, die von der Polizei auf lokaler Ebene durchgeführt werden, die in vielen Fällen die Ursache für die Unsicherheit der Menschenrechtsverteidiger sind. Die angebotene psychologische Unterstützung ist bestenfalls unzureichend, und man verlässt sich zu sehr auf einen Ortsumzug. Dies mag notwendig sein, ist aber nicht die Lösung, nach der die Menschenrechtsverteidiger suchen, insbesondere diejenigen aus traditionellen Gemeinschaften und Journalisten, die vor Ort arbeiten. Auch beim Schutzniveau gibt es große Unterschiede zwischen den Staaten“, so der Bericht.
Der Staat sei sich all dieser Probleme bewusst und prüfe Möglichkeiten zur Verbesserung des Programms. Die Sonderberichterstatterin ist der Ansicht, dass in Erwägung gezogen werden sollte, die volle Verantwortung für den Schutz von Menschenrechtsverteidiger:innen den Bundesbehörden zu übertragen.
Eines der auffälligen gemeinsamen Elemente vieler Angriffe auf Menschenrechtsverteidiger:innen in Brasilien sei, so der Bericht, dass die Menschenrechtsverteidiger:innen, die Gemeinschaften, aus denen sie kommen, und in vielen Fällen auch die Gesellschaft im Allgemeinen über die Identität der Angreifer informiert sind. In einigen Fällen sind auch die Behörden informiert. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle entkämen die Täter jedoch ungestraft. „Polizeiliche Versäumnisse, mangelnder Ermittlungswille oder Absprachen mit den Tätern führen dazu, dass viele Fälle nie über das Ermittlungsstadium hinausgehen. Institutionelle Diskriminierung ist ein weiterer Faktor. In den Fällen, in denen es zu einer Strafverfolgung kommt, gibt es wiederum Hindernisse und mächtige Interessen, die ins Gewicht fallen. In den seltenen Fällen, in denen es zu einem Prozess kommt, kann es Jahre dauern, bis ein Urteil gefällt wird.“
Die Angriffe auf Menschenrechtsverteidiger:innen in Brasilien seien extrem gewalttätig, die Risiken sind weit verbreitet und allgegenwärtig, und die am stärksten marginalisierten und diskriminierten Personen seien am stärksten gefährdet, nämlich: Indigene und Quilombola-Menschenrechtsverteidiger:innen sowie Menschenrechtsverteidiger:innen aus anderen traditionellen Gemeinschaften, aus ländlichen Gebieten und der arbeitenden Bevölkerung sowie Schwarze Frauen und Transgender-Frauen, die sich für die Menschenrechte einsetzen. In vielen Fällen sei der Täter der Staat, oft die Polizei. In anderen Fällen handelt es sich bei den Angreifern um Farmer:innen, Geschäftsleute und deren private Sicherheitsdienste, und Täter mit politischen Verbindungen werden von lokalen Behörden geschützt. „Die Art und Weise, wie in Brasilien Geschäfte gemacht werden, die zum großen Teil von ausländischem Kapital und Unternehmen vorangetrieben werden, trägt zur Unsicherheit und zu Menschenrechtsverletzungen im Allgemeinen bei“, so das Resümée des Berichts.
Empfehlungen der UN-Sonderberichterstatterin an Brasilien
Die Sonderberichterstatterin empfiehlt unter anderem dem Präsidenten Brasilien, den Schutz von Menschenrechtsverteidiger:innen zu garantieren und ein Ende der Straflosigkeit zu erwirken und fordert dafür, dass die Bekämpfung der Straffreiheit für Verbrechen zu einer Priorität der föderalen Regierung gemacht werde und fordert die Zusammenarbeit aller staatlichen Behörden, um den Schutz der Menschenrechtsverteidger:innen zu gewährleisten. Dazu gehöre auch die „weitere Stärkung der staatlichen Organe für den Schutz der Menschenrechte, einschließlich der Menschenrechte im Zusammenhang mit Land, Umwelt und der Bekämpfung des Klimawandels [und die] Gewährleistung einer ausreichenden Finanzierung dieser Stellen. Mary Lawlor fordert zudem, dass der Oberste Gerichtshof STF die entsprechenden Verfassungsbeschwerden Petitionen zum Bundesgesetz Nr. 14.701 (die Stichtagsreglung „Marco Temporal“ betreffend, Anm.d.A) vorrangig zu behandeln“ habe.
Die Sonderberichterstatterin empfiehlt zudem, dass das Ministerium für Menschenrechte und staatsbürgerliche Teilhabe die Verantwortung für die Umsetzung des Schutzprogramms für Menschenrechtsverteidiger vollständig an die Bundesregierung zu übertragen habe, in Zusammenarbeit mit Behörden auf Landesebene.
Sie empfahl zudem, dass die Regierung die Empfehlungen der technischen Arbeitsgruppe Sales Pimenta umsetze (siehe ausführlichen Hintergrundtext hier) und dass die Regierung ein nationales Systems zur Erhebung von aufgeschlüsselten Daten über Angriffe auf Menschenrechtsverteidiger:innen aufzubauen habe, dies im Einklang mit entsprechenden Urteilen des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte.
Der Bericht empfiehlt des Weiteren die Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Umwelt und Klimawandel zur Gewährleistung der uneingeschränkten Achtung der Menschenrechte und der Umwelt sowie der Eindämmung des Klimawandels. Dazu sollen im Einklang mit den Leitlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen über verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln und deren Leitprinzipien zu Wirtschaft und Menschenrechten erarbeitet und verabschiedet werden. um brasilianische Unternehmen und die im nationalen Hoheitsgebiet tätigen multinationalen Unternehmen zu verpflichten, die Menschenrechte vollumfänglich zu achten. Ein besonderes Augenmerk solle dabei „auf die Hochrisikosektoren, einschließlich Bergbau, Agrarindustrie, Holzeinschlag, Tourismus und Energieerzeugung“ gelegt werden.
Die Sonderberichterstatterin empfiehlt zudem, dass das Ministerium für Justiz und öffentliche Sicherheit in enger Zusammenarbeit mit dem Ministerium für indigene Völker und die zuständigen Behörden "mit höchster Dringlichkeit" die Demarkierung von Land vorantreiben sowie folgende Protokolle in Absprache mit Menschenrechtsverteidiger:innen und der Zivilgesellschaft erarbeiten sollen: Obligatorische Schulungen für die Polizei über Menschenrechtsverteidiger:innen; Untersuchung mutmaßlicher Straftaten gegen Menschenrechtsverteidiger:innen, um sicherzustellen dass Vergeltungsmaßnahmen für ihren Menschenrechtsaktivismus als mögliches Motiv für Verbrechen gegen sie berücksichtigt werde; Erwägung der Ausarbeitung spezifischer Rechtsvorschriften über die Anwendung von Gewalt durch die Polizei im Einklang mit den Grundprinzipien für den Einsatz von Gewalt und Schusswaffen durch Strafverfolgungsbeamt:innen und dem Verhaltenskodex für Strafverfolgungsbeamt:innen.
Die Sonderberichterstatterin empfiehlt außerdem, dass das Ministerium für landwirtschaftliche Entwicklung und Familienlandwirtschaft, in enger Zusammenarbeit mit dem Ministerium für ethnische Gleichheit, sowie mit den zuständigen Behörden die Titulierung des Quilombola-Landes mit äußerster Dringlichkeit behandele.
Die Sonderberichterstatterin empfiehlt zudem, dass das Ministerium für Umwelt und Klimawandel in Zusammenarbeit mit der Bundesstaatsanwaltschaft die Entwicklung eines Protokoll für die wirksame Verfolgung von Umweltverbrechen zu entwickeln habe und die Liste der zu schützenden Baumarten erweitern solle. Dies könne eine schnelle Maßnahme gegen Waldrodung sein. Und es sollten dringend Programme erarbeitet werden, die Anreize für den Schutz der Wälder und die Verhinderung der Entwaldung auf staatlicher und kommunaler Ebene bewirken.
Das Ministerium für Frauen solle sich dafür einsetzen, dass die Angriffe auf weibliche Menschenrechtsverteidigerinnen und ihre Familienangehörigen enden, und dabei besonderes Augenmerk zu richten sei auf die Angriffe auf indigene, Quilombola- und Frauen traditioneller Völker und Gemeinschaften, auf Schwarze Frauen und auf Landarbeiterinnen. Dazu solle das Ministerium für Frauen eine Kartierung der Gewalt gegen Menschenrechtsverteidigerinnen und ein Protokoll über die Sicherheit von Menschenrechtsverteidigerinnen in den Gebieten indigener, Quilombola- und traditioneller Völker erarbeiten.
Die Sonderberichterstatterin empfiehlt, dass das Ministerium für indigene Völker „die vollständige Einhaltung der ILO-Konvention über indigene und in Stämmen lebende Völker des Übereinkommens von 1989 (Nr. 169) sowohl bei staatlichen als auch bei privatwirtschaftlichen Projekten zu gewährleisten“ habe und dabei die Interessen und Traditionen der betroffenen Gemeinschaften besonders zu berücksichtigen seien. Besonderes Augenmerk habe den folgenden Wirtschaftssektoren zu gelten: Bergbau, Holzeinschlag, Agrarindustrie (insbesondere Soja-, Mais- und Eukalyptusplantagen sowie Rinderzucht), CO2-Gutschriftenhandel, Infrastruktur-Entwicklung sowie Energieerzeugung. Des Weiteren müssten proaktive Maßnahmen ergriffen werden, die die Rechte der indigenen und traditionellen Völker und Gemeinschaften, einschließlich ihres Rechts auf Selbstbestimmung, verwirklichen. Dies beinhalte die Respektierung und Einhaltung von Konsultations- und Zustimmungsprotokollen, die von indigenen Völkern selbst entwickelt wurden.
Die Sonderberichterstatterin empfiehlt dem Ministerium für ethnische Gleichheit, die proaktiven Maßnahmen anzuerkennen und zu unterstützen, die von Quilombola, Flussanwohnenden und anderen traditionellen Völkern ergriffen werden, um ihre Rechte zu verwirklichen, einschließlich ihres Rechts auf Selbstbestimmung. Dazu gehöre die Achtung und Einhaltung von Konsultations- und Zustimmungs-Protokolle, die von traditionellen Völkern erarbeitet wurden und die definieren, wie im Zusammenhang mit Aktivitäten, die ihr Land betreffen, das Vorgehen von Dritten strikt im Einklang mit der ILO-Konvention 169 zu stehen habe.
In den Empfehlungen der UN-Sonderberichterstatterin werden die Regierungen und Behörden der drei Bundesstaaten Bahia, Pará und Mato Grosso do Sul namentlich aufgefordert, als dringende Angelegenheit die Untersuchung von Morden und Drohungen gegen Menschenrechtsverteidiger aufzunehmen, um dergestalt sicherzustellen, dass die Täter:innen vor Gericht gestellt werden und dass allen gefährdeten Menschenrechtsverteidiger:innen ein wirksamer und angemessener Schutz geboten werde. Diese drei Bundesstaaten werden desgleichen angehalten, endlich Fortschritte bei der Demarkierung und Titulierung von Territorien der Indigenen, der Quilombola und anderer traditioneller Völker und Gemeinschaften voranzubringen. Diese Landtitulierung solle unter anderem durch Überprüfung der Rechtmäßigkeit aller bestehenden Konzessionen für Unternehmen, die solches Land betreffen, erfolgen. Dies müsse ebenfalls in Übereinstimmung mit den Vorgaben der ILO-Konvention Nr. 169 erfolgen.
Die Sonderberichterstatterin empfiehlt der Regierung und den zuständigen Organen des Staates São Paulo, ein Abkommen mit der Bundesregierung abzuschließen, um ein Schutzprogramm für Menschenrechtsverteidiger:innen im Bundesstaat aufzustellen. Des Weiteren müsse eine obligatorische Verwendung von Körperkameras durch alle Polizeibeamt:innen eingeführt und durchgesetzt werden, um die Kontrollierbarkeit und Verantwortlichkeit für staatliche Gewalt zu gewährleisten. Die Regierung und die Behörden von São Paulo wurden zudem aufgefordert, von der Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger:innen Abstand zu nehmen. Gefordert wird von São Paulo eine Gesetzgebung zur Einführung eines wirksamen, schnellen und transparenten Prozesses der Wiedergutmachung, einschließlich psychologischer Unterstützung, für die Angehörigen der Opfer von Polizeigewalt sowie die Gewährleistung der Unabhängigkeit der gerichtsmedizinischen Untersuchungen in allen Fällen.
Die Sonderberichterstatterin empfiehlt, dass der Nationale Justizrat ein verbindliches Protokoll für die gerichtliche Behandlung von Fällen, die mutmaßliche Verbrechen gegen Menschenrechtsverteidiger betreffen, einschließlich der Schaffung eines Mechanismus für beschleunigte Verfahren, verabschiede.
Die Sonderberichterstatterin empfiehlt, dass der Nationale Rat der Staatsanwaltschaften ein verbindliches Protokoll für die strafrechtliche Verfolgung von Fällen gegen Menschenrechtsverteidiger:innen entwickele, das sicherstellt, dass Vergeltungsmaßnahmen für ihren Menschenrechtsaktivismus als mögliches Motiv als Straftat in Betracht gezogen werden könne.
Der Bundesstaatsanwaltschaft empfiehlt die Sonderberichterstatterin, dass das Büro des Föderalen Ombudsmannes der Situation gefährdeter Menschenrechtsverteidiger – insbesondere der Frage der Straflosigkeit bei Verbrechen gegen sie – weiterhin besondere Aufmerksamkeit widmen müsse und dass die Einrichtung einer speziellen Arbeitsgruppe zur Situation von Menschenrechtsverteidiger:innen in Betracht zu ziehen sei.
Die Sonderberichterstatterin empfiehlt allen in Brasilien tätigen Unternehmen, ihre Geschäfte unter Achtung der Menschenrechte und der Umwelt zu führen und gleichzeitig die Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen. Dies habe zu erfolgen in voller Übereinstimmung mit internationalen und regionalen Menschenrechtsgesetzen und regionalen Menschenrechtsnormen, einschließlich der ILO-Konvention Nr. 169, der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte indigener Völker, der Erklärung über Menschenrechtsverteidiger:innen und der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der Bauern und anderer in ländlichen Gebieten arbeitender Menschen. Zudem fordert die UN-Sonderberichterstatterin von allen in Brasilien tätigen Unternehmen Unterstützung im Hinblick auf die unverzügliche Ratifizierung des Escazú-Abkommens durch Brasilien sowie die Unterstützung der Ausarbeitung nationaler Rechtsvorschriften über Menschenrechte und Sorgfaltspflicht für Unternehmen im Einklang mit den OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen über verantwortungsvolles Geschäftsgebaren und die Leitprinzipien zu Wirtschaft und Menschenrechten.

